- Kultur
- Musik
Can »Future Days«: Krautrock ohne Sauerkraut
Vor 50 Jahren gelang der Band Can mit »Future Days« ein angenehm undeutsches Album
Musikjournalisten sind Ordnungsfanatiker. In das Gewusel und Gewimmel unzähliger Alben und Songs versuchen sie System reinzubringen. Das verlangt die Zielgruppe von ihnen. Ein Country-Fan, der es betulich mag, möchte nicht durch unerwartete Punk-Klänge verstört werden.
Leider ist es mit solch groben Einteilungen nicht getan. Die Popmusik hat im Lauf der Jahrzehnte ein Maß an Komplexität erreicht, das von der Einfachheit des 50er-Jahre-Rock’n’Roll Galaxien entfernt ist. Jeder Stil lässt sich mit anderen Stilen verschneiden. Selbst Country-Punk (auch bekannt als Cowpunk) ist seit den 80ern nichts Ungewöhnliches mehr. Auf diese Weise ist aus wenigen Genre-Schubladen ein gigantischer Karteikartenschrank geworden.
Das erschwert die Beschreibung von Musik. Wie muss man sich »Prog-Rock-inspirierten Neofolk-Pop mit Trip-Hop-Anklängen« vorstellen? Da helfen nur konkrete Vergleiche weiter. Gern greifen Musikjournalisten zu Formulierungen der Art »klingt wie …«. Durch solche Bezugspunkte bekommen Leser eine Vorstellung davon, wie ein bestimmtes Album sich anhören könnte – vorausgesetzt, sie kennen das Werk, auf das verwiesen wird.
Can mussten nie über sich lesen »klingen wie …«, denn sie waren die Ersten, damals in den späten 60ern und frühen 70ern. Sie hatten das Glück, sich in einer Zeit musikalisch ausprobieren zu dürfen, in der Experimentierfreude belohnt wurde. Und besonders viel Glück hatten sie 1971, als ihr Song »Spoon« (Löffel) für den TV-Dreiteiler »Das Messer« als Titelmelodie ausgewählt wurde. Dass ein avantgardistisches Stück Platz sechs der deutschen Verkaufscharts erreichte (direkt hinter Tony Marshalls »Komm, gib mir deine Hand«), das hat es danach nie wieder gegeben.
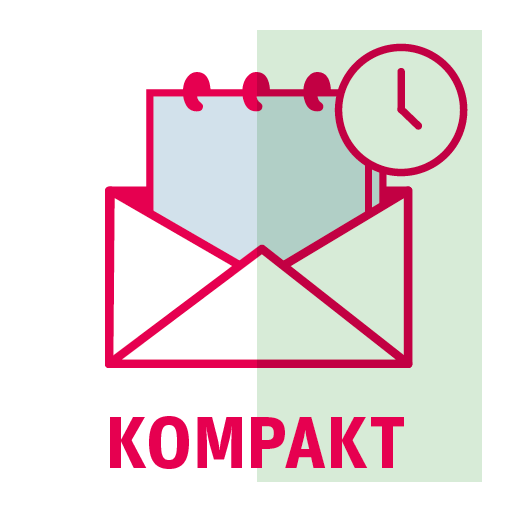
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Aber es war ohnehin einiges anders bei Can. Keines der Bandmitglieder konnte eine jugendtypische Rock-Sozialisation vorweisen. Man orientierte sich an Stockhausen, nicht an den Stones. Der Keyboarder Irmin Schmidt und der Bassist Holger Czukay hatten bei ihm an der Musikhochschule Köln Komposition studiert. Der Flötist David C. Johnson war dort sogar Dozent und assistierte eben jenem Stockhausen bei Aufführungen. Der Schlagzeuger Jaki Liebezeit wiederum kam vom Free-Jazz. Auch der Gitarrist Michael Karoli hatte vorher in Jazzbands gespielt.
Man nannte sich zunächst Inner Space. Ein treffender Name. Das Musizieren war kein Selbstzweck. Es ging darum, durch Experimentieren mit Klängen das Innenleben hörbar zu machen. Das erste Can-Album »Monster Movie« war folglich psychedelisch gefärbt – seinerzeit, 1969, nicht untypisch für Selbstfindungsphasen von Musikern.
Natürlich erhielt auch diese Platte ihr Etikett. Diesmal von englischen Musikjournalisten. Sie sprachen von »Krautrock« und meinten damit experimentelle elektronische Musik, die aus dem Land der »Sauerkrauts«, also aus Deutschland kam.
Das ist im Fall von Can insofern ungerecht, als ihre Alben überhaupt nicht deutsch klingen. Zum Beispiel verzichteten sie darauf, den Rest der Welt mit Botschaften zu behelligen. Die Laute, die der japanische Straßenmusiker Damo Suzuki auf den darauffolgenden Werken »Tago Mago«, »Ege Bamyası« und »Future Days« von sich gibt, haben nur wenig mit konventionellem Gesang zu tun. Die Stimme hat den Charakter eines Instruments, das der Can’schen Klangtapete einige Farbtupfer hinzufügt.
Und »experimentell« heißt eben auch nicht – trotz der Stockhausen-Wurzeln – nervig bis unhörbar. Vor allem »Future Days«, das vor 50 Jahren erschien, verbreitet eine Leichtigkeit, die man den notorisch schwermütigen Deutschen nicht zugetraut hätte. Doch wie klingt das Ganze nun konkret? »Nach elektronischem Pop, bevor der wirklich erfunden war. Ich dachte beim ersten Hören: Aha, da kommen Air, Portishead und Radiohead also her!« (Tom Lenz).
Und Can machten bereits Ambient-Musik, bevor Brian Eno 1978 mit »Ambient 1: Music for Airports« das Genre offiziell zur musikalischen Bebauung freigab. Wobei man besser von Landschaftsbau mit reichlich Wildwuchs sprechen sollte. Hier werden Soundparks mit Irrgärten erschaffen, in denen sich die Zuhörer wohlig verlieren können.
Das liegt an der Grundstimmung des Albums. »Future Days« verbreitet den Optimismus einer Zeit, in der man die Zukunft noch freudig erwartete. Auch das ist ein Grund, dieses Album wiederzuentdecken.

Wir behalten den Überblick!
Mit unserem Digital-Aktionsabo kannst Du alle Ausgaben von »nd« digital (nd.App oder nd.Epaper) für wenig Geld zu Hause oder unterwegs lesen.
Jetzt abonnieren!
Das »nd« bleibt gefährdet
Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







